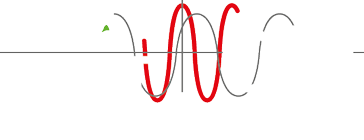Mehr Kraft - mehr Werk
Fernwärmebereich im Energiemuseum „KraftWerk“ neu gestaltet
Eiserne Rohre, umhüllt mit Asbest, Filz und Papier, das Ganze in einem mit Sägemehl gefüllten Holzkasten in die Erde versenkt: So verlegte man die weltweit ersten Fernwärmeleitungen in den USA. In Dresden verwendete man Mitte des vorigen Jahrhunderts vor allem Glaswolle mit einem Hartmantel aus Gips und Nesselgewebe als Isolierung. Eine Rekonstruktion solch eines Rohrstückes kann im neu gestalteten Fernwärmebereich im Energiemuseum „KraftWerk“ bewundert werden.
Der Rundgang beginnt mit einer Würdigung des ersten Fernwärmenetzes in Europa: Schautafeln und ein Film zeigen das unter König Albert vor 110 Jahren errichtete „Fernheiz- und Elektrizitätswerk“ an der Packhofstraße, welches u. a. die Hofkirche, das königliche Schloss, Oper und Zwinger mit Dampf versorgte.
Ventil mit Ziegelstein
Wir haben in den vergangenen Jahren zahlreiche historische Exponate gesammelt, die uns heute teils staunen, teils schmunzeln lassen: Wer erinnert sich noch an die Heizkörper aus Porzellan, die vor allem in den Wohngebieten um den Sternplatz installiert waren?
In der Borsbergstraße wurde ein Stück verzinktes Stahlrohr geborgen, dem Ausblühungen wie „Blumenkohl“ anhaften: Trinkwarmwasser war sukzessive aus der korrodierten Verschraubung ausgetreten und hatte u.a. Kalzium- und Magnesium Salze zurückgelassen. Zur Schau gestellt werden verschiedene Rohre: starre und flexible Stücke aus Kupfer und Stahl, ausgekleidet mit Plaste, isoliert mit Kamelith oder Polyurethanschaum.
Prima wäre es, wenn wir noch einige seltenere Exponate finden könnten, z.B. Glasrohre aus Ilmenau oder Rohre für die Warmwasser-Installation mit innenliegender Zirkulationsleitung.
Relikt im Freigelände
Ausgestellt ist unter anderem ein seinerzeit sehr begehrter Kohle-Gliederkessel GK 21, welcher viele Besucher an eigene zentrale Schwerkraft-Heizungsanlagen erinnern wird. Ein richtig großer Gliederkessel GK 71 wurde von den Auszubildenden der DREWAG aufgearbeitet.
Das ca. zwei Tonnen schwere Relikt wird demnächst im Freigelände aufgestellt. In solche Kessel schaufelten unsere Kollegen bis zu zehn Tonnen Kohle pro Tag!
Im modernen Teil der Ausstellung erfährt der Besucher, dass die Inselnetze und Einzelobjekte heute effizient mit Fernwärme, Gas oder Öl beheizt werden.
Die Bedeutung des GT-HKW Nossener Brücke als größter Fernwärmeproduzent in Dresden und der weitere Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung werden besonders anschaulich gemacht.